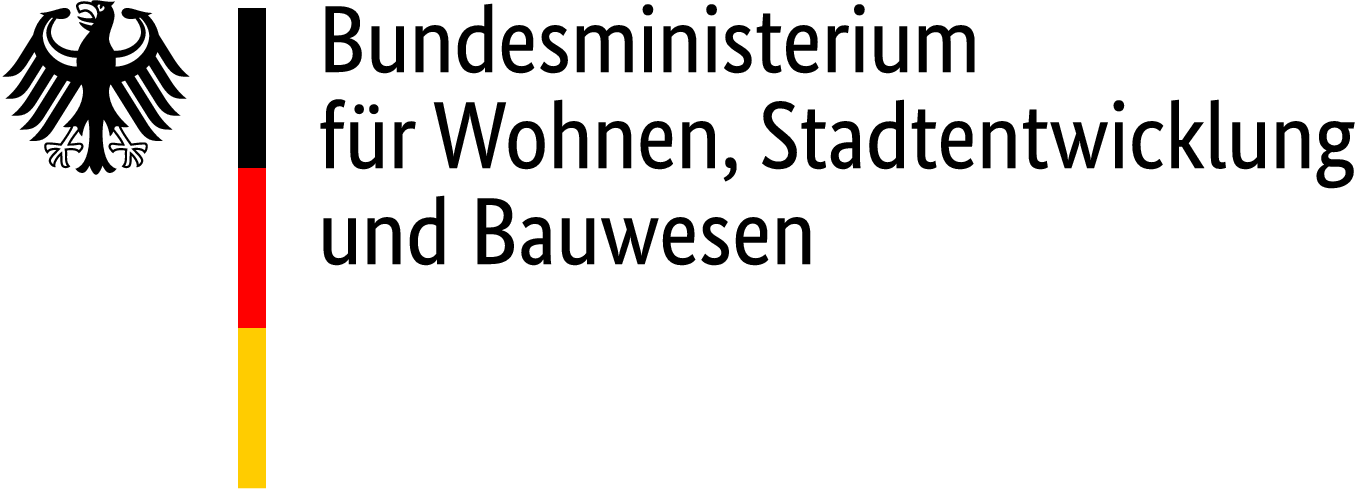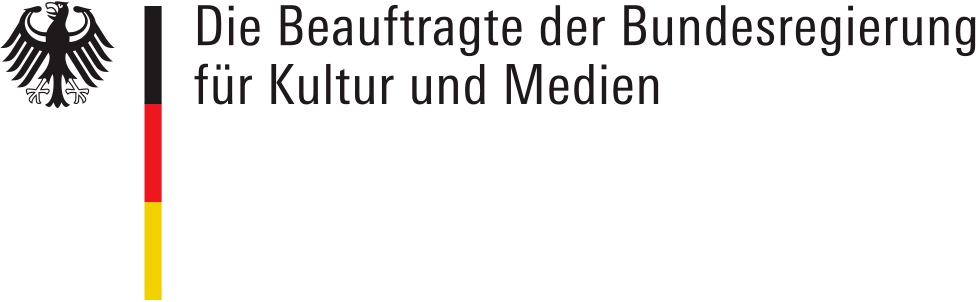Was jede Nachbarschaft zu bieten hat sind Geschichten! Mit dem Geschichtenerzähl-Workshop kann man sie im öffentlichen Raum sammeln und in die Welt hinaus senden. Im Idealfall hat man hierfür eine Geschichtenerzählstation zur Verfügung – eine Kiste aus Sperrholz, in der sich Mikrofon, Aufnahmegerät und Lautsprecher befinden, um Anekdoten und spannende Geschehnisse in der Nachbarschaft aufzuzeichnen und anschließend wieder abzuspielen. Die Geschichten werden von ihren Erzähler*innen aus dem Stadtteil selbst eingesprochen und können als Podcast, Audioinstallation oder im lokalen Bürger*innen-Radio zugänglich gemacht werden. Bei Bedarf kann man über das spontane Erzählen und Aufnehmen der Geschichten hinausgehen und in umfangreicheren Workshops Sprechtexte schreiben, ein Sounddesign erstellen, Technikworkshops anbieten oder Hörspiele aus den Geschichten aus der Gegend produzieren. Und wer nicht erzählen möchte, kann beispielsweise seine Geschichte auch malen und sie von anderen Teilnehmenden vertonen lassen. In oder auf der Sperrholzbox können auch die Bilder wieder ausgestellt werden und die Box so eine Nachbarschaftliche Gestaltung auch nach außen erfahren.
Und falls man gerade keine Geschichtenerzähltstation zur Hand hat, tut es auch ein Diktiergerät oder Fieldrecorder auf einem Klapptisch mit zwei Stühlen, an welchem die Geschichten gesammelt werden können.
Unter Anleitung des Bildenden Künstlers Marcio Carvalho wurde ein Kiosk auf dem zentralen Sackträgerplatz im Mannheimer Stadtteil Jungbusch umgestaltet und als partizipatives und dynamisches Denkmal neu etabliert. Ausgangspunkt dafür war das für den Platz namensgebende Sackträgerdenkmal. Als spielerische Komponente dafür wurden Glückskekse produziert, die am Kiosk ausgegeben wurden und Fragen enthielten, die zu einer Reflexion über die eigene Geschichte und das Leben im Stadtteil anregten. Die Antworten der Befragten wurden dokumentiert und als dauerhafte Video-Installation im Schaufenster des Kiosks installiert. Die Statements der Stadtteilbewohner:innen wurden zudem auf einer digitalen Laufschrift abgespielt. So entstand ein reger Austausch zwischen den Stadtteilbewohner:innen und ihre Geschichten erhielten eine prominente Repräsentationsfläche in Mitten des Stadtteils.
Für die Veröffentlichung auf einer gemeinsamen Website werden Sedcards kultureller Gruppen erstellt. Diese Sedcards bestehen aus einem Text zu den Aktivitäten der Gruppe, Aufnahmen aus einem Fotoshooting/ Videodreh, sowie Informationen und Hintergrundwissen zur Community. Die Gruppen werden im Gespräch und in Aktion zeigt, zum Beispiel bei einem Auftritt on stage. Dabei wäre es wichtig, ein möglichst optimales Ergebnis gleichbleibender Qualität zu erzielen und dadurch die Kulturaktivitäten der Laiengruppen wertschätzend und ansprechend zu präsentieren. Durch das gemeinsame Erlebnis, kommen die Gruppen miteinander in Kontakt, besonders wenn zu dem Shooting Termin verschiedene kulturelle Gruppen eingeladen werden. Sie selber reflektieren die eigene Kulturarbeit und ihre Ziele. Gleichzeitig werden sie durch die Veröffentlichung nach außen sichtbar. Indem die „kulturelle Schätze“ präsentiert werden, wird auch das Image des Stadtteils gestärkt. Anwohner/ Zuschauer werden motiviert, selbst kulturell aktiv zu werden.
Das Plakazin ist eine Mischung aus Magazin / Zine und Plakat. Während die Vorderseite des innovativ gefalteten Plakates Themen des Quartiers in Magazinform bearbeitet, ist auf die Rückseite ein Plan des Quartiers zu sehen.
In jeder Ausgabe wird eine neue Facette der urbanen Wirklichkeit im Plan gezeigt. Im Magazinteil kommen Nachbar*innen zu Wort.
Eine Übersetzung der Texte in andere Sprachen, die im Quartier gesprochen werden, empfiehlt sich. Diese können über einen QR-Code online aufgerufen werden.
Das Plakazin wurde kostenlos im Quartier in Hausbriefkästen verteilt und darüber hinaus in der gesamten Stadt an einschlägigen Standorten verteilt.
Ein Feuer als zentraler Versammlungsort bei Veranstaltungen ist ein Magnet für alle Passant:innen. Vor allem mitten in der Stadt. Seit Urzeiten ist die Feuerstelle der Ort für Gemeinschaft, Austausch, Sinnieren und die Zubereitung von Nahrung. Und das funktioniert auch heute noch; nicht nur in der kalten Jahreszeit!
Anwohner*innen, die entweder professionelle oder Hobby-Fotograf*innen sind betrachten das Quartier durch einen künstlerischen Blick. Die Fotograf*innengruppe entwickelt zu einem vorgegebenen Thema eigenständig eine Ausstellung, die entweder an einem zentralen Ort im Quartier oder auch im öffentlichen Raum stattfinden kann. Die Nachbarschaft lernt ihre Straßen und bekannten Orte neu kennen, entdeckt Neues, identifiziert sich mit dem Bezirk, kommt miteinander ins Gespräch.
Beim Stadtteil Walk präsentiert sich die Bewohnerschaft eines Quartiers den Besucher*innen aus anderen Stadtteilen, um der im öffentlichen Diskurs vorherrschenden Defizitorientierung und der Reduzierung auf bekannte Problemlagen entgegenzuwirken. Der Fokus wird dabei jeweils auf ein bestimmtes Thema gelegt, welches die Stärken und Ressourcen des Quartiers in den Vordergrund rückt und von verschiedenen Redner*innen aus dem Quartier vorgetragen wird. Beim Stadtteilrundgang erzählen die Bewohner*innen persönliche Geschichten, Historisches und Aktuelles über den Stadtteil und beziehen sich dabei auf ein vorher erarbeitetes Thema. Gemeinsam präsentieren sie ihren Stadtteil und setzen positive Konnotationen.
Im Stadtteil werden in der Adventszeit an viele unterschiedliche Menschen und Institutionen kleine Tüten verschenkt. Darin befindet sich ein Rezept, Ausstechformen und Material zum Verzieren von Plätzchen. Die Menschen aus der Nachbarschaft können so zu Hause Plätzchen backen. Neben den Materialen für die Plätzchen befindet sich in jeder Tüte zudem eine weitere, kleine Tüte, die dazu einlädt einen Teil der Plätzchen an andere Menschen, wie z.B. den eigenen Nachbar*innen, zu schenken. Jede*r Bäcker*in kann ein Foto der eigenen Plätzchenkreationen einreichen, die dann auf der Homepage veröffentlicht wird. So entsteht ein partizipatives Projekt für die ganze Nachbarschaft trotz Kontaktbeschränkungen
Eine Person geht mit einem Aufnahmegerät durch den Bezirk und spricht Passant*innen an: „Haben Sie Lust mir eine Geschichte zu erzählen?“ Wer Interesse hat, kann sich vorher ein bis zwei kurze Geschichten von anderen Bewohner*innen des Bezirks anhören, als Anregung und Inspiration. Anschließend kann die eigene Geschichte erzählt werden und wird per Aufnahmegerät mitgeschnitten. Diese Geschichte wird weitergetragen zu anderen Passant*innen – so vermehren sich die Geschichten Stück für Stück. Beim Geschichtentausch entsteht ein Dialog mit den Menschen aus dem Quartier. Die Offenheit der Anwohner*innen ermutigt wieder andere sich ebenfalls am Dialog zu beteiligen.
Ein Ausschnitt einer jeden Geschichte wird auf der Webseite veröffentlicht. So entsteht eine Art Podcast-Reihe, die eine große Auswahl von Geschichten über Erfahrungen, den Bezirk, Lebensgefühle und andere Themen beinhaltet. Diese Podcast-Reihe bildet die Vielfalt der Stadtteilbewohner*innen ab – und somit auch die Vielfalt an Wünschen, Sorgen, Aktivitäten und Meinungen.
Hier geht es zum Geschichtentausch-Podcast des TPZ Hildesheim
Briefe ermöglichen in Zeiten des Lockdowns und „sozialer Distanz“, einander nah zu bleiben und zu kommen. Die Nachbarschaft kann sich mithilfe des mittlerweile altertümlich erscheinenden Mediums Brief auf einfache Weise miteinander vernetzen. Ein weiterer Vorteil ist, dass auch Zielgruppen, die nicht Internet-affin sind, erreicht werden und mitmachen können.
So geht’s:
-
- Nachbar*innen per Einwurf in den Briefkasten oder Aushänge im öffentlichen Raum zum Mitmachen aufrufen. Interessierte können einen Steckbrief mit Name, Adresse, Alter und Interessen bzw. Hobbies verfassen und ihn per Brief an die Koordinierungsstelle senden oder dort in den Briefkasten werfen.
- Die Koordinierungsstelle sichtet die Steckbriefe und vernetzt Anwohner*innen mit ähnlichen Interessen und Hobbies miteinander. Es können z.B. Brieffreundschaften zwischen Literaturbegeisterten, Sportler*innen, Hobby-Köch*innen etc. geknüpft werden. Andere Faktoren wie Alter, Geschlecht, Herkunft sollten bei der Vernetzung keine Rolle spielen.
- Steckbrief der zu vernetzenden Bewohner*innen mit Anschrift versenden, wobei Anwohner A den Steckbrief der Anwohnerin B erhält. Ein kurzes Anschreiben kann beigelegt werden.
Der von den Anwohner*innen zu verfassende Steckbrief kann beliebig erweitert werden, hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt (z.B. Lieblingsorte, Vermeidungsorte im Kiez etc.). Es sollten jedoch nicht zu viele Punkte abgefragt werden, so dass die Aktion niedrigschwellig bleibt und viele Anwohner*innen zur Teilhabe animiert werden. Die Steckbriefe eignen sich übrigens auch gut als Bedarfsanalyse für die Stadtteilarbeit!