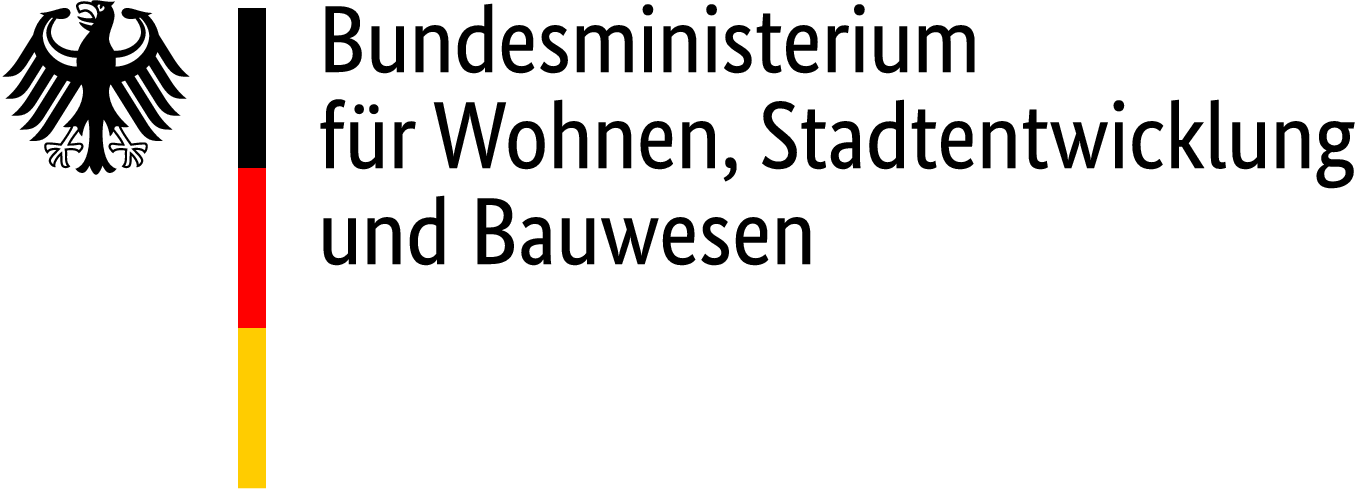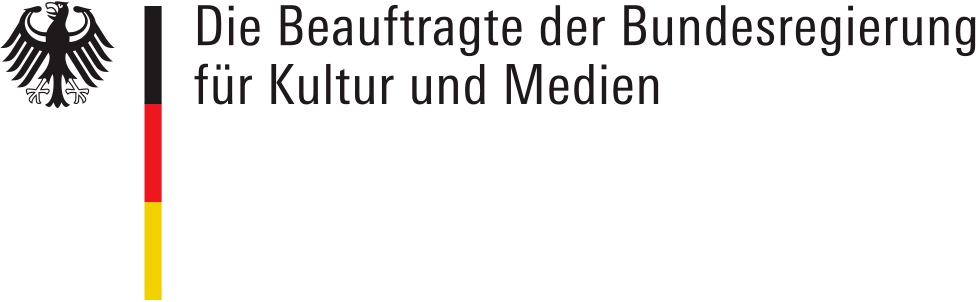Sport-, Spiel- und Spaßaktionen für Kinder auf einem zentralen öffentlichen Platz laden zu einem friedvollen und dennoch ausgelassenen Miteinander ein: Ob kreative Aktionen zum Ausleben der Kreativität, Bewegungsspiele, sportliche Aktivitäten, Musik oder Tanz an verschiedenen Stationen auf dem Platz – ausgelassenes Kinderlachen ist höchst erwünscht!
Weiterhin haben wir zu diesem Anlass nicht nur getanzt oder Rasseln gebaut sondern auch einen PopUp-Garten installiert… Hier zählt auf jeden Fall das gemeinschaftliche Miteinander und das zusammen Spaß haben.
Unter Anleitung einer erfahrenen Referentin trafen sich regelmäßig Hobbyfotograf*innen, um fotografisch den Stadtteil zu erkunden. Hierbei sammelten sie nicht nur Impressionen aus dem Kiez sondern konnten ihre fotografischen Fertigkeiten und Fähigkeiten erweitern. So wurden die Rundgänge u.a. immer mit einem Schwerpunkt versehen, z.B. Mikro oder Makrofotografie, Tiere, Schatten, Jahreszeiten, Weitwinkel, Farben, etc.
Die besten entstandenen Fotos wurden für den Stadtteilkalender ausgewählt, der alljährlich seit 2021 gemeinsam mit dem Bürgerverein Neustadt e.V. herausgegeben wird. Weiterhin wurden die schönsten Fotos von den Teilnehmer*innen ausgewählt und in einer Ausstellung im Stadtteil präsentiert.
Für das Format „Foyer“ wird einer Gruppe von Menschen eine Räumlichkeit der Einrichtung zur Verfügung gestellt und gemeinsam mit ihnen ein Nutzungskonzept entwickelt, das ihre spezifischen Bedarfe miteinbezieht. In Eigenverantwortung oder mit der Unterstützung ein*er Künstler*in wird der entsprechende Raum für eine Dauer von etwa 2-3 Monaten umgestaltet und das neue Nutzungskonzept etabliert. Das neue „Foyer“ dient dabei als eigenständige und autarke Projektfläche und zusätzlich als Foyer für das übrige Veranstaltungsprogramm der Einrichtung. Auf diese Weise werden verschiedene Zielgruppen zusammengeführt und es entsteht ein wertvoller Austausch, der andernfalls nicht zustande käme. Die Art und Weise, wie der Raum genutzt und modifiziert wird, ist völlig frei.
Ladet euch interessante Bürgerinnen und Bürger aus dem Quartier ein und redet mit ihnen über alle Themen, die interessant sind. Vom Musiker mit Wurzeln aus einem Land, über ehrenamtlich stark engagierte Bürgerinnen und Bürger, von Schulkindern bis zu einem Senior, der ein Kinderbuch schreibt oder Neubürgerinnen und Neubürger mit Migrationshintergrund – der Vielfalt der Gäste sind keine Grenzen gesetzt. Stellt ein Aufnahmegerät (wir nutzen den Zoom H2N) oder das Handy, sorgt dafür, dass es um euch rum möglichst ruhig ist und stellt euren Gästen Fragen rund um ihr Leben, ihre Tätigkeit, ihre Hobbies und was immer euch interessant erscheint.
Danach den Podcast mit einem Schnittprogramm (z.B. Audacity, kostenfrei) schneiden und dann auf entsprechenden Podcast-Plattformen oder Homepage online stellen und schon ist eure Podcast-Folge fertig!
Eine Video Werkstatt für Jugendliche aus dem Quartier bietet den jungen Bewohner*innen die Möglichkeit, ihre eigene Perspektive auf ihr Umfeld und das Leben zu präsentieren.
An einem wöchentlichen, festen Termin werden verschiedene, selbst gewählte filmische Projekte umgesetzt. Die Perspektive durch die Videokamera bietet einen Anlass, das Quartier auf besondere Art und Weise in den Blick zu nehmen, sich in der Nachbarschaft zu bewegen und Drehorte zu suchen und bei journalistischen Ideen, Menschen zu befragen.
Bei den wöchentlichen Terminen finden je nach Wünschen der Teilnehmenden Konzeption, Filmaufnahmen oder Filmschnitt statt.
Mit der Mosaik-Box gab es die Möglichkeit den Workshop „Gestalte dein eigenes Porzellan“ während des Lockdowns weiterhin anzubieten.
Von zuhause aus konnte jede*r Teilnehmer*in Porzellan-Geschirr gestalten, dekorieren. Für ein freies Gestalten von eigenen Collagen wurde neben einem Porzellan-Service eine Sammlung an Motiven
(Bilder und Illustrationen auf Transferfolie) bereitgestellt. Das Geschirr, die Motive und die Anleitung in Papierform wurden in die MOSAIK-BOX gepackt und an die Teilnehmer*innen geliefert.
Es sind ganz wunderbare Unikate entstanden. Jedes Porzellanteil ziert seine eigene Collage.
Eine Mediengruppe aus Nachwuchs-Reporter*innen begleitet kulturelle Projekte und schafft dadurch Öffentlichkeit vor allem in der jüngeren Generation, indem sie die eigenständig medial aufbereiteten Inhalte teilt. Gleichzeitig werden in Zeiten des Zeitungssterbens Jugendliche über die Sozialen Medien hinaus auch an die klassischen Medien herangeführt und dafür begeistert, da die Mediengruppe alle Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit bedienen soll. Medien-Kooperationspartner ermöglichen den jungen Reporter*innen Einblick in die Arbeit der Medien, professionelle Journalist*innen begleiten die Berichterstattung und vermitteln den Jugendlichen erstes Rüstzeug für die Medienarbeit. Wegen der Corona-Pandemie konnten wir das Tool nur in Teilen realisieren. Als sehr erfolgreich erwiesen sich eine von Schüler*innen unter Anleitung organisierte Podiumsdiskussion und die Aufbereitung dieses Events durch die Mediengruppe sowie die Erstellung von Kolumnen für die örtliche Lokalzeitung.
Halloween kann zum Anlass genommen werden, eine Kürbis-Gestaltungs-Aktion für ALLE (Halloween-Fans und Nicht-Halloween-Fans! ) anzubieten, bei der neben den ‚klassischen‘ Halloween-Motiven auch ein breites Spektrum an sonstigen Arten der Kürbis-Gestaltung angeboten wird. Um die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten zu erweitern, bietet sich die Kombination von Schnitz- und (An-)Maltechniken an.
So ist es auch empfehlenswert, als Material neben Halloween-Kürbissen auch verschiedene essbare Kürbis-Arten zu verwenden. (Diese müssen keineswegs vergeudet werden: Nach einem ersten Leben als „Kunst-Werk“, können sie in einem zweiten Leben immer noch als Lebensmittel verwendet werden).
Beim Schnitzen kann das „Weg-Schnitzen“ (Entfernen von Kürbis-Flächen) bestens mit dem „An-Schnitzen“ (Entfernen nur der äußeren Fruchtschale) ergänzt werden. Dafür eignen sich insbesondere Linol- oder Holzschnitz-Sets. Die Kombination mit dem (An-)Malen erweitert die Bandbreite spannender Möglichkeiten, einen Kürbis zu gestalten, noch erheblich.
Meloakustika lud Menschen ein, ohne eigenes Instrument oder Vorkenntnisse nach Gehör und dem Prinzip »Each one teach one« alle möglichen Streich- und Zupfinstrumente zu lernen. Aus der Zusammenarbeit mit einem Musikpädagogen entwickelte sich ein Ensemble aus Laienmusiker*innen und professionellen Musiker*innen aller Alters- und Gesellschaftsschichten, viele von ihnen ohne jegliche musikalische Vorbildung. Das Mehrgenerationen-Projekt fasste eine Altersspanne von 8 bis 80 Jahren um.
Statt um die Erreichung virtuoser Könnerschaft — die oft bei Musikensembles vorausgesetzt wird — ging es hier um intuitives Lernen, Freude am gemeinsamen Musizieren und die Entwicklung einer temporären Gemeinschaft in der jede*r einen Platz finden konnte. Noten lesen, Vorkenntnisse oder der Besitz eines eigenen Instruments waren keine Voraussetzung. Dieser niedrigschwellige Zugang ermöglichte vielen Menschen die Teilhabe. Eine verbindliche Anmeldung oder regelmäßige Teilnahme war nicht nötig.
Das Format Meloakustika Unterwegs, das als Variante für die pandemische Lage entwickelt wurde, eröffnete Möglichkeiten, gemeinsam im Freien zu musizieren und dabei gleichzeitig neue Interessenten zu gewinnen. Während die Musiker*innen Orte wie den Quartiersplatz aufsuchten, um dort ein Konzert zu geben, wurden parallel Flyer an die Zuschauer*innen verteilt und die Menschen angesprochen und ermutigt, an dem Konzert teilzunehmen oder zukünftige Ensemble Treffen zu besuchen. Durch direkte Kontakte und eine mehrsprachige Ansprache (Bulgarisch, Türkisch, Englisch) konnten viele neue Teilnehmer*innen erreicht werden, darunter zum Teil auch diejenigen, die in der Regel schwer zu aktivieren sind.
Leute zusammen auf ein Foto zu bringen, die sich (bisher) noch gar nicht kennen, obwohl sie im selben Stadtteil wohnen. Das war und ist Ziel des Fotografen Tilman Köneke. Über ein Jahr hinweg baute er an verschiedenen Orten in der Neustadt ein mobiles „Studio“ auf und lichtete Menschen ab, die sich dort das erste Mal unterhielten. Ausgestellt im ex-sultanmarkt bekamen diese Begegnungen nun ihre Bühne.