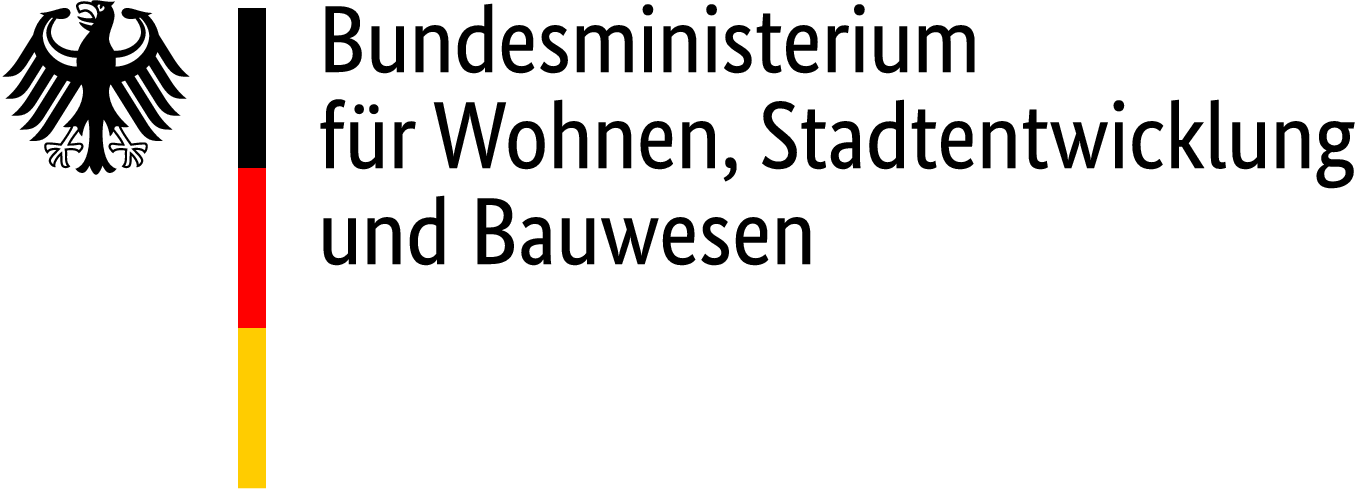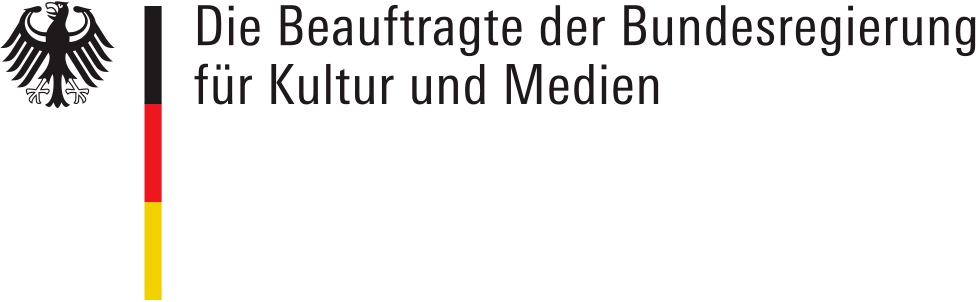Sport-, Spiel- und Spaßaktionen für Kinder auf einem zentralen öffentlichen Platz laden zu einem friedvollen und dennoch ausgelassenen Miteinander ein: Ob kreative Aktionen zum Ausleben der Kreativität, Bewegungsspiele, sportliche Aktivitäten, Musik oder Tanz an verschiedenen Stationen auf dem Platz – ausgelassenes Kinderlachen ist höchst erwünscht!
Weiterhin haben wir zu diesem Anlass nicht nur getanzt oder Rasseln gebaut sondern auch einen PopUp-Garten installiert… Hier zählt auf jeden Fall das gemeinschaftliche Miteinander und das zusammen Spaß haben.
In der Stadt gibt es keine Tiere und sowieso ist alles Beton?
Wer das glaubt, kann sich in einem geführten Spaziergang durch das Stadtgebiet vom Gegenteil überzeugen lassen. Mit einem Experten/ einer Expertin, hier: einem Ranger der Naturwacht geht es auf die Spuren von Tier und Pflanze im urbanen Raum. Man wird staunen, was da tagtäglich und bisher noch unbemerkt alles kreucht und fleucht. Und so manches Kraut kann man sogar inmitten der Stadt entdecken und probieren. Schon mal Löwenzahnsalat probiert oder “Honig” aus Blüten selbst gemacht?
Es gibt viel zu entdecken!
Mit ausleihbaren Bau-Sets für Lichtskulpturen kann die Möglichkeit geschaffen werden, Licht und Freude in die Nachbarschaft zu senden. Ohne Kontaktbeschränkungen sind auch direkte Workshops unter künstlerischer Anleitung möglich.
Das Stecksystem, welches vom Künstler Jörn Hanitzsch stammt, ist etwas für Jung und Alt; einfach zu handhaben und nahezu grenzenlos in seiner Gestaltung. Alles was ihr braucht, ist ein Balkon oder ein Platz an welchem die Lichtskulptur sicher stehen kann. Die Ideen kommen spätestens beim Bauen und weil ihr eine Lichtskulptur in kürzester Zeit umsetzen könnt, können sogar immer wieder neue Strukturen und Verbindungen geknüpft werden.
Das macht es natürlich besonders spannend zu beobachten, wer es in der Nachbarschaft stilistisch minimal oder opulent hält, wer vielleicht miteinander wetteifert oder sich einfach nur an seiner eigenen Arbeit erfreut.
Eine ganz neue Möglichkeit also, seine Nachbarn besser kennenzulernen…
Meloakustika lud Menschen ein, ohne eigenes Instrument oder Vorkenntnisse nach Gehör und dem Prinzip »Each one teach one« alle möglichen Streich- und Zupfinstrumente zu lernen. Aus der Zusammenarbeit mit einem Musikpädagogen entwickelte sich ein Ensemble aus Laienmusiker*innen und professionellen Musiker*innen aller Alters- und Gesellschaftsschichten, viele von ihnen ohne jegliche musikalische Vorbildung. Das Mehrgenerationen-Projekt fasste eine Altersspanne von 8 bis 80 Jahren um.
Statt um die Erreichung virtuoser Könnerschaft — die oft bei Musikensembles vorausgesetzt wird — ging es hier um intuitives Lernen, Freude am gemeinsamen Musizieren und die Entwicklung einer temporären Gemeinschaft in der jede*r einen Platz finden konnte. Noten lesen, Vorkenntnisse oder der Besitz eines eigenen Instruments waren keine Voraussetzung. Dieser niedrigschwellige Zugang ermöglichte vielen Menschen die Teilhabe. Eine verbindliche Anmeldung oder regelmäßige Teilnahme war nicht nötig.
Das Format Meloakustika Unterwegs, das als Variante für die pandemische Lage entwickelt wurde, eröffnete Möglichkeiten, gemeinsam im Freien zu musizieren und dabei gleichzeitig neue Interessenten zu gewinnen. Während die Musiker*innen Orte wie den Quartiersplatz aufsuchten, um dort ein Konzert zu geben, wurden parallel Flyer an die Zuschauer*innen verteilt und die Menschen angesprochen und ermutigt, an dem Konzert teilzunehmen oder zukünftige Ensemble Treffen zu besuchen. Durch direkte Kontakte und eine mehrsprachige Ansprache (Bulgarisch, Türkisch, Englisch) konnten viele neue Teilnehmer*innen erreicht werden, darunter zum Teil auch diejenigen, die in der Regel schwer zu aktivieren sind.
Leute zusammen auf ein Foto zu bringen, die sich (bisher) noch gar nicht kennen, obwohl sie im selben Stadtteil wohnen. Das war und ist Ziel des Fotografen Tilman Köneke. Über ein Jahr hinweg baute er an verschiedenen Orten in der Neustadt ein mobiles „Studio“ auf und lichtete Menschen ab, die sich dort das erste Mal unterhielten. Ausgestellt im ex-sultanmarkt bekamen diese Begegnungen nun ihre Bühne.
Zum Start braucht es einen Zusammenschluss von im Quartier lebenden Menschen: so etwas wie einen Quartiers-Rat oder zumindest eine Liste von im Quartier lebenden und dort engagierten Personen.
Diesen wird nun
- eine Frage gestellt: “Welche Begriffe fallen Dir/Ihnen zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unseres Quartiers ein? Bitte alphabetisch ordnen!” –> So entstehen akkumulierte Begriffe zu jedem Buchstaben des Alphabets.
- braucht es schreiblustige Menschen im Quartier, die sich mit diesen Begriffen beschäftigen und zu je 1 Buchstaben Berichte, Erzählungen oder auch Gedichte schreiben, in Verwendung möglichst (nicht unbedingt) aller von der Quartiers-Croud genannten Begriffen.
- braucht es im Quartier lebende oder mit ihm verbundene Fotograf*innen, Maler*innen, Digital-Zeichner*innen, die entweder autonom zu den Begriffssammlungen (A, B, C …) oder zum bereits erstellten (A-/B-/C-)Text Bilder finden oder erstellen.
Vor Final werden aus den Bildern + Texten (zunächst digital) Info-Tafeln mit je gleichem Design erstellt.
Final werden diese 26 (Anzahl = Buchstaben im Alphabet) Info-Tafeln – wie sonst andere zu erzählenswerten Besonderheiten – im Quartier aufgehangen.
So vielfältig wie die Menschen, die in unserer Stadt leben, so vielfältig ist die Oberhausener Küche. Beim gemeinsamen Kochen und anschließendem Essen an einer großen Tafel auf einem zentralen öffentlichen Platz tauschen sich die Bewohner*innen des Quartiers untereinander aus, lernen sich und ihre Kulturen kennen, (er)leben Gemeinschaft und vernetzten sich mit anderen Quartiersbewohner*innen.
„Ein gutes Essen bringt gute Leute zusammen“, sagte schon Sokrates. Und wenn man gemeinsam kocht, schmeckt es gleich nochmal so gut 😁
Gerade in einem Stadtteil, in dem viel gebaut wird, viel in Entwicklung ist, sind kleine und große Entwurfszeichner und Zeichnerinnen gefragt!
Mit einer Malvorlage, die eine typische oder aktuelle Kulisse im Stadtteil skizzenhaft anreißt, lassen sich gut Impulse sammeln für die Gestaltung von Freiräumen im Quartier. Bewohner*innen können ihre Bedürfnisse und Fantasien zum Ausdruck bringen. Wunschträume sind willkommen: Welches Haus würdest Du in die Baulücke stellen? Wie sieht Dein Traum vom Wohnen und Leben im Stadtteil aus? Hast Du eine Idee, wer hier einziehen könnte? Wie sieht Dein Traum von Nachbarschaft aus?
Je nach Material, das zur Verfügung steht, kann gezeichnet, gemalt, geschmückt oder auch collagiert werden. Ein Bild kann einzeln oder mit anderen zusammen erstellt werden. Ein großer Werkeltisch hält unterschiedlichste Stifte, Scheren, Papiere, Perlen, vielleicht auch Glitzer bereit. Prospekte, Flyer und Werbematerialien eignen sich mit Bildvorlagen zum Ausschneiden, ebenso wie Worte, die als Gedankenanstöße mit eingeklebt werden. Der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt.
Die Entwürfe ergeben, beispielsweise an einer langen Leine nebeneinander aufgehängt, ein interessantes heterogenes Bild von gemeinschaftlich gestalteten Straßenzügen, Häuserzeilen und Stadtteilszenarien.
Zwei Personen begeben sich verkleidet als Laborant*innen auf die Straße und kommen mit Bewohner*innen des Stadtteils ins Gespräch. Sie befragen sie nach ihren Wünschen für den Stadtteil und geben dabei Anregungen mithilfe kleiner Gedichte, Sprüche oder philosophischer Fragen. Aus den Antworten werden spontane Lieder entwickelt und den Teilnehmenden mit Musikinstrumenten wie einer Flöte, Gitarre oder Melodica vorgespielt, gleichzeitig werden die Antworten notiert.
Als Belohnung erhalten die Teilnehmenden ein gemeinsames Foto mit den Glücksforscher*innen. Dieses wird mit einer Polaroid-Kamera geschossen und direkt ausgehändigt; gleichzeitig erhalten die Glücksforscher*innen ein Foto für ihre Dokumentation.
Die Glücksforscher*innen können sowohl auf der Straße als auch bei Stadtteilfesten und -Aktionen auftreten.
Verschiedene Gruppen und Einzelpersonen jeden Alters aus dem Quartier gestalten einen Stromkasten mit eigenen Motiven. Die Stromkästen bilden eine Galerie im öffentlichen Raum, die auch digital im Stadtplan verzeichnet ist. Durch das Scannen eines aufgeklebten QR-Codes kommen die Betrachtenden zu Google Maps und können den entsprechenden Stromkasten dort finden und anklicken. Ein kleiner Text informiert über die Künstler:innen und das Motiv.
Für die Gestaltung der Stromkästen kann ein mobiler Farb- und Materialwagen, der zwischen den verschiedenen Gruppen und Personen, die sich an der Gestaltung beteiligt sind, weitergegeben benutzt werden.
Paint it! verbindet die Aufwertung des Quartiers durch die Bemalung / Verschönerung der häufig verschmutzten Stromkästen mit sozialen Aspekten: Die verschiedenen Teilnehmenden finden eine Möglichkeit ihre Interessen und Persönlichkeit im Stadtraum zu präsentieren. Die Weitergabe der Farben macht die Kommunikation zwischen den verschiedenen Gruppen und Personen nötig und fördert die Nachbarschaft.
Zum Ende der Bemalung können alle Stromkästen bei einem gemeinsamen Rundgang durch die „Outdoor-Galerie“ bewundert werden.