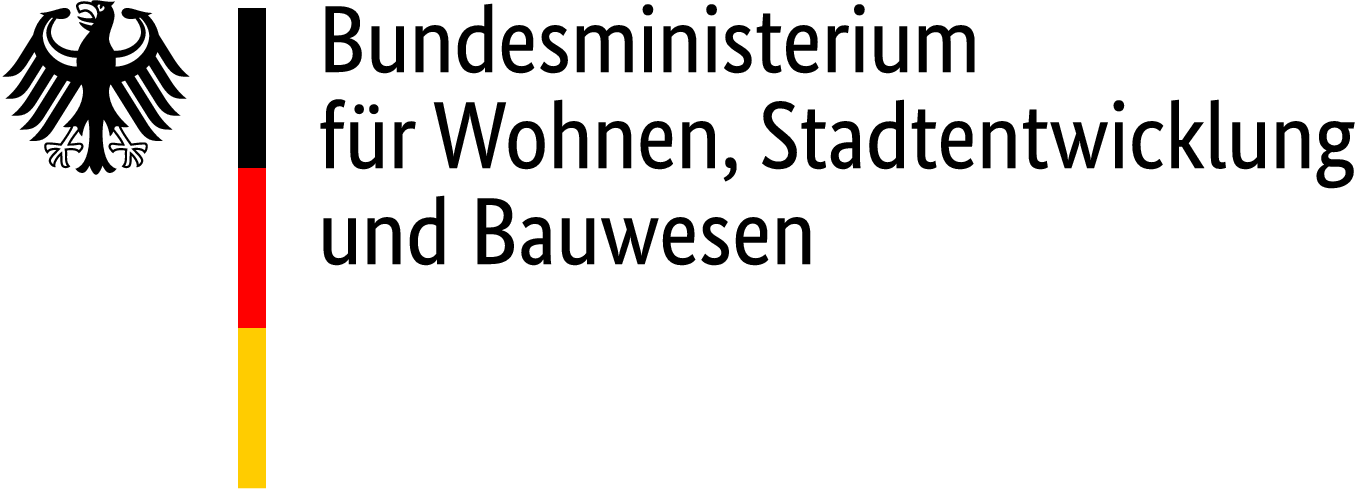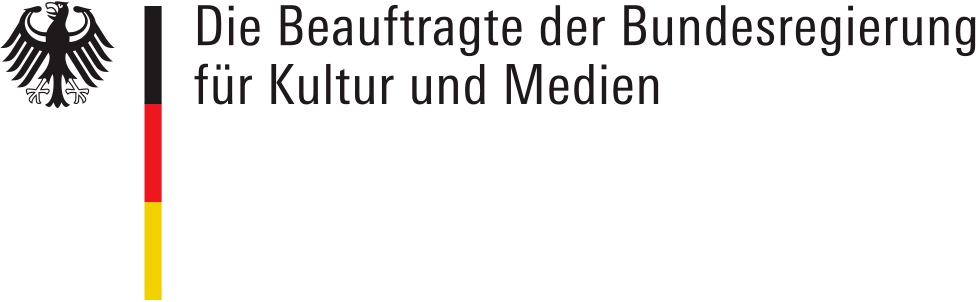Während des Lockdowns bzw. unter Auflagen zur Eindämmung der Pandemie Kunst und Kultur für Alle anzubieten, erforderte viel Fantasie bzw. erforderte ein Umdenken; wenn Begegnungen nur eingeschränkt möglich sein konnten, wollten wir trotzdem Freude schenken und Kunst erlebbar machen. Daraufhin kreierten wir gemeinsam mit der Künstlerin Sandra Bilkenroth eine Kunstinstallation. Ausgehend vom Moritzhof, über den Moritzplatz sollten WinterWunderWelt-Elemente im gesamten Quartier zu finden sein.
Wolken, Sterne, der Mond, Schneeflocken, Weihnachtskugel-Fantasietiere, wurden an „Leinen“ über den gesamten Innenhof des Moritzhofes aufgehängt. Mit Lichtelementen erstrahlten sie besonders in der winterlichen Dunkelheit besonderes schön. Wenn die Besucher*innen den Hof betraten, schauten sie in eine winterliche Wolkenwelt – in eine verzauberte „Anderswelt“ über ihren Köpfen.
Weiterhin wurden 24 Elemente in der gesamten Neustadt (bei Kooperationspartner*innen, in Geschäften, Restaurants und in Schulen verteilt) und wie ein Adventskalender täglich bis zum Weihnachtsfest auf unserer Facebookseite präsentiert.
Die Weihnachtspostkarte des Projektes wurde als „Grüße aus der WinterWunderWelt“ an Projektpartner*innen versandt.
In der Neustadt gibt es Kunstwerke im öffentlichen Raum, von verschiedenem Künstler*innen angefertigt. Fassadenmalerei (Urbanart), Skulpturen usw. In unserer Kunstkarte sind es 16 Positionen, die in einem 8-seitigen DinA6 Leporello aufgelistet wurden. Sie erscheinen als eine Collage, die nummeriert wurden und auf einem entsprechenden Ausschnitt im Stadtplan bei Google auftauchen. Der Faltplan führt wie ein Reiseführer zu den verschiedenen Kunstwerken.
In der Stadt gibt es keine Tiere und sowieso ist alles Beton?
Wer das glaubt, kann sich in einem geführten Spaziergang durch das Stadtgebiet vom Gegenteil überzeugen lassen. Mit einem Experten/ einer Expertin, hier: einem Ranger der Naturwacht geht es auf die Spuren von Tier und Pflanze im urbanen Raum. Man wird staunen, was da tagtäglich und bisher noch unbemerkt alles kreucht und fleucht. Und so manches Kraut kann man sogar inmitten der Stadt entdecken und probieren. Schon mal Löwenzahnsalat probiert oder “Honig” aus Blüten selbst gemacht?
Es gibt viel zu entdecken!
Unter Anleitung einer erfahrenen Referentin trafen sich regelmäßig Hobbyfotograf*innen, um fotografisch den Stadtteil zu erkunden. Hierbei sammelten sie nicht nur Impressionen aus dem Kiez sondern konnten ihre fotografischen Fertigkeiten und Fähigkeiten erweitern. So wurden die Rundgänge u.a. immer mit einem Schwerpunkt versehen, z.B. Mikro oder Makrofotografie, Tiere, Schatten, Jahreszeiten, Weitwinkel, Farben, etc.
Die besten entstandenen Fotos wurden für den Stadtteilkalender ausgewählt, der alljährlich seit 2021 gemeinsam mit dem Bürgerverein Neustadt e.V. herausgegeben wird. Weiterhin wurden die schönsten Fotos von den Teilnehmer*innen ausgewählt und in einer Ausstellung im Stadtteil präsentiert.
Ziel dieser Kreativ-Aktion ist die vielfältige Gestaltung von Plastik-Kugeln zum Aufhängen.
Die Kugeln existieren in verschiedenen Größen (aus unserer Sicht sind Kugeln mit 8 – 10 cm Durchmesser zu empfehlen) und bestehen aus 2 Halbkugeln, die nach dem Gestaltungs-Akt zusammengesetzt werden.
Die Kugeln können auf mannigfaltige Arten gestaltet/geschmückt werden, so z.B. durch:
• Bemalen (Sonderstifte oder Acrylfarbe im Innern),
• Beschriften (versch. Marker-Arten),
• Befüllt werden mit unterschiedlichsten Materialien oder (Kunst-)Werken wie z.B. Filzfiguren, modellierten Figuren, im Winter auch mit ‚Schnee‘, Moos, Tannenzapfen, Trockenblumen…
und natürlich der Kombination all dieser verschiedenen Möglichkeiten.
Natürlich ist dieses Angebot nicht zwingend mit Weihnachten oder Weihnachtsmotiven verbunden.
Für das Format „Foyer“ wird einer Gruppe von Menschen eine Räumlichkeit der Einrichtung zur Verfügung gestellt und gemeinsam mit ihnen ein Nutzungskonzept entwickelt, das ihre spezifischen Bedarfe miteinbezieht. In Eigenverantwortung oder mit der Unterstützung ein*er Künstler*in wird der entsprechende Raum für eine Dauer von etwa 2-3 Monaten umgestaltet und das neue Nutzungskonzept etabliert. Das neue „Foyer“ dient dabei als eigenständige und autarke Projektfläche und zusätzlich als Foyer für das übrige Veranstaltungsprogramm der Einrichtung. Auf diese Weise werden verschiedene Zielgruppen zusammengeführt und es entsteht ein wertvoller Austausch, der andernfalls nicht zustande käme. Die Art und Weise, wie der Raum genutzt und modifiziert wird, ist völlig frei.
Ladet euch interessante Bürgerinnen und Bürger aus dem Quartier ein und redet mit ihnen über alle Themen, die interessant sind. Vom Musiker mit Wurzeln aus einem Land, über ehrenamtlich stark engagierte Bürgerinnen und Bürger, von Schulkindern bis zu einem Senior, der ein Kinderbuch schreibt oder Neubürgerinnen und Neubürger mit Migrationshintergrund – der Vielfalt der Gäste sind keine Grenzen gesetzt. Stellt ein Aufnahmegerät (wir nutzen den Zoom H2N) oder das Handy, sorgt dafür, dass es um euch rum möglichst ruhig ist und stellt euren Gästen Fragen rund um ihr Leben, ihre Tätigkeit, ihre Hobbies und was immer euch interessant erscheint.
Danach den Podcast mit einem Schnittprogramm (z.B. Audacity, kostenfrei) schneiden und dann auf entsprechenden Podcast-Plattformen oder Homepage online stellen und schon ist eure Podcast-Folge fertig!
Recherche: Zu einem bestimmten (politischen) Thema werden Fotos z.B. auf Instagram/Facebook und im direkten Umfeld recherchiert. Entsprechende Urheber*innen werden kontaktiert und angefragt, ob ihr Foto in einer Ausstellung gezeigt werden darf. Gesammelte Fotos werden ausgedruckt und als Ausstellung präsentiert. Die Idee ist es, Fotos z.B. aus direkt betroffenen Krisenregionen zu erhalten oder auch verschiedene Sicht-Perspektiven zu einem Thema zusammenbringen zu können, Presse- oder Kunst-Fotografien.
Ein*e Kurator*in verständigt sich per WA/Insta/FB/Zoom mit den Urheber*innen.
Mit ausleihbaren Bau-Sets für Lichtskulpturen kann die Möglichkeit geschaffen werden, Licht und Freude in die Nachbarschaft zu senden. Ohne Kontaktbeschränkungen sind auch direkte Workshops unter künstlerischer Anleitung möglich.
Das Stecksystem, welches vom Künstler Jörn Hanitzsch stammt, ist etwas für Jung und Alt; einfach zu handhaben und nahezu grenzenlos in seiner Gestaltung. Alles was ihr braucht, ist ein Balkon oder ein Platz an welchem die Lichtskulptur sicher stehen kann. Die Ideen kommen spätestens beim Bauen und weil ihr eine Lichtskulptur in kürzester Zeit umsetzen könnt, können sogar immer wieder neue Strukturen und Verbindungen geknüpft werden.
Das macht es natürlich besonders spannend zu beobachten, wer es in der Nachbarschaft stilistisch minimal oder opulent hält, wer vielleicht miteinander wetteifert oder sich einfach nur an seiner eigenen Arbeit erfreut.
Eine ganz neue Möglichkeit also, seine Nachbarn besser kennenzulernen…
Eine Video Werkstatt für Jugendliche aus dem Quartier bietet den jungen Bewohner*innen die Möglichkeit, ihre eigene Perspektive auf ihr Umfeld und das Leben zu präsentieren.
An einem wöchentlichen, festen Termin werden verschiedene, selbst gewählte filmische Projekte umgesetzt. Die Perspektive durch die Videokamera bietet einen Anlass, das Quartier auf besondere Art und Weise in den Blick zu nehmen, sich in der Nachbarschaft zu bewegen und Drehorte zu suchen und bei journalistischen Ideen, Menschen zu befragen.
Bei den wöchentlichen Terminen finden je nach Wünschen der Teilnehmenden Konzeption, Filmaufnahmen oder Filmschnitt statt.