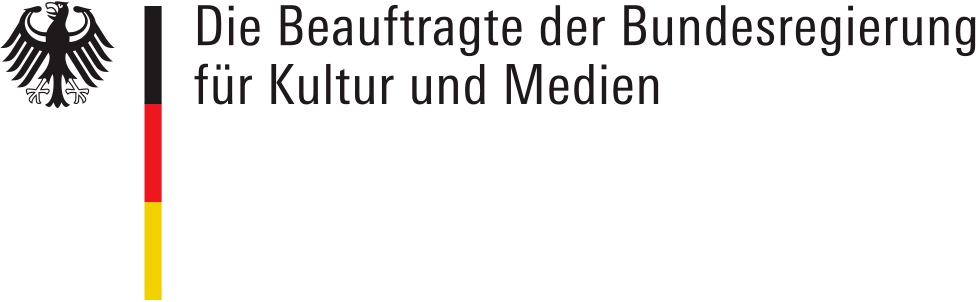Mobile Stadtspiele sind Schnittstelle von analogem Raum und kreativer Nutzbarmachung von Smartphones. Sie bieten neue Möglichkeiten der Stadterkundung und der Entwicklung kultureller Angebote. In diesem Labor werden theoretische Grundlagen vermittelt und praktische Erfahrungen mittels der „Tempelhofer Schnitzeljagd“ gemacht.
Der Workshop vermittelte in drei Schritten die Grundlagen der Spielentwicklung. Ziel war es, die Potenziale des Game Designs als eine innovative und intrinsische Lernmethode den Teilnehmer*innen anhand eigener Erfahrungen näher zu bringen und Überlegungen für kulturelle Angebote an der Schnittstelle von urbanem Raum und der kreativen Nutzung von Smartphones als Instrument der spielerischen Stadterkundung zu erzeugen. Der Workshop bestand aus drei Teilen und einer gemeinsamen Reflektion zu potentiellen Anwendungsmöglichkeiten in soziokulturellen Einrichtungen.
Zuerst wurden die Lieblingsspiele der Teilnehmer*innen in einer Vorstellungsrunde abgefragt und unmittelbar eine Zuordnung in verschiedene Spielformen vorgenommen, z.B. Brettspiele, Computerspiele, Rollenspiele oder Spiele im öffentlichen Raum. Dabei wurde über das Grundprinzip des Spielens diskutiert und auch Erfahrungen aus der Kindheit und somit der Akt des Spielens als einer Urform des »Begreifens« herausgearbeitet.
Darauf folgte eine Gruppenübung, bei der die Teilnehmer*innen bereits zu Spieleentwicklern wurden. Mit Hilfe von drei identischen Gegenständen wurden von acht Gruppen acht verschiedene Spiele erzeugt. Hierbei lernten sie auf unsichtbare Weise (learning by doing, informelles Lernen) Ziel, Mechanik, Belohnung und Regeln zu definieren. Erst bei den anschließenden Präsentationen wurden diese Grundpfeiler des Game Designs besprochen und näher erörtert.
Drittes Element des Workshops war ein mobiles Stadtspiel, bei dem die Teilnehmer*innen in mehreren Teams die unmittelbare Umgebung des Tagungsortes ufaFabrik anhand eines vorgefertigten Schnitzeljagd-Parcours erkunden und dabei über ein Punktesystem miteinander in den Wettbewerb treten konnten. Das zentrale Steuerungselement war eine Smartphone-App, mit der die Teilnehmer*innen Orte finden, Gegenstände entdecken, Fragen beantworten und weitere Aufgaben bewältigen mussten. Dabei wurde auch ein Schwerpunkt auf die lokalhistorische Wissensvermittlung rund um den Bezirk Tempelhof gelegt. Aber auch der günstigste Joghurt im Supermarkt um die Ecke musste innerhalb eines vorgegebenen Zeitlimits käuflich erstanden werden.
Bei der Auswertung wurden die gesammelten Erfahrungen reflektiert und die methodische Nutzbarkeit diskutiert. In der Schnitzeljagd wurde von vielen das Potenzial für eine generationsübergreifende Begegnung (Lebenserfahrung trifft digital Native) entdeckt. Die 30-minütige Spieldesign-Übung war für die meisten Teilnehmer*innen – wie auch für den Workshopleiter – ein tiefgreifendes Erlebnis. Hierbei wurden Teamwork, verschiedenstes Wissen und diverse Fertigkeiten sowie schnelle Entscheidungsprozesse miteinander gekoppelt. Die Teilnehmer*innen äußerten zum Schluss viele Ansätze für den Einsatz von Spielentwicklungsmethoden in der täglichen Arbeit mit unterschiedlichen Zielgruppen der Soziokultur.
Welche kreativen Methoden könnten angewandt werden, um Netzwerke und Kooperationen aufzubauen? Wie bringe ich über Kunst neue Impulse in aktuelle Stadtdiskurse ein? Dieses Labor gibt Einblicke in innovative Maßnahmen und zeigt unkonventionelle Wege um Aufmerksamkeit für neue kulturelle Angebote im Quartier zu erzeugen.
1. Einführung in die Praxis des ZKU – seine Kooperationen und Strategie
Im Vordergrund der Einführung in die Praxis des ZK/U stand die Entstehungsgeschichte des Hauses im Jahr 2012, und wie sich ohne eine Form der institutionellen Förderung ein sozio-kulturelles Programm entwickeln konnte. Hierbei standen Fragen der Finanzierung, Netzwerke und Kooperationen im Mittelpunkt. Im kritischen Dialog wurden des Weiteren Kommunikationsstrategien, Altersheterogenität der Besucher, lang- und kurzfristige Zielsetzungen erörtert. Über ein klassisches Organigramm hinaus, wurde eine schematische Darstellung des ZK/U präsentiert, das die ökonomischen, sozialen und kulturellen Kapitalarten in ein Verhältnis zur Organisation setzt und so eine über den monetären Kapitalfluss hinausgehendes, für die Arbeit von sozio-kulturellen Zentren relevantes, Erklärungsmodell präsentierte.
- Einführung in künstlerische Intervention des Künstlerkollektivs KUNSTrePUBLIK
Die Potentiale von Kunst im öffentlichen Raum, von Interventionen mit künstlerischen Mitteln, wurden anhand von einigen konkreten Beispielen erläutert.
In Uljanovsk, Russland, baute KUNSTrePUBLIK ein Orakel, das eine freie Äußerung von Fragen und Antworten erlaubte. Sie unterhielten einen fahrbaren Protestbrunnen in Washington D.C.. Sie produzierten einen ikonischen Würfel, um die Interessen von Kleinhändlern in einem Markt in Jakarta zu stärken. Sie re-interpretierten bekannte Opern und präsentierten diese in abgebrannten Autos, um anstehende Gentrifizierung zu markieren. Sie formierten ein Straßenparlament mit den Gesängen von Fußballfans und den Schwimmwesten von Geflüchteten. Sie bauten eine Autowaschanlage, um Arbeitsmigranten mit Willkommensliedern und einem Taufritual im Ruhrgebiet zu empfangen.
KUNSTrePUBLIK kuratierte über die eigene Arbeit hinaus verschiedene Projektserien mit dem Ansatz ein umfassenderes gesellschaftliches Bild zu zeichnen: mit der 2jährigen Projektreihe ‚Archipel Invest‘ wurden mikro-ökonomische Zukunftsszenarien für das post-industrielle nördliche Ruhrgebiet entwickelt, im Skulpturenpark Berlin-Zentrum wurden innerhalb von 5 Jahren auf einer innerstädtischen Brachfläche urbane Entwicklungsdynamiken mit künstlerischen Projekten kommentiert und diskutiert.
Die Präsentation führte zu einer Diskussion bezüglich der Fragen der Wirkung und Nachhaltigkeit solcher Projekte und eröffnete Einsichten in die Ziele von sozio-kultureller Arbeit im Allgemeinen.
- Emergency Kit“: Gemeinsamer Brainstorm zur Ermittlung kreativer Problemlösungen für Herausforderungen des ZK/U
Mit dem ‚Emergency Kit‘ sollten die Impulse aus Teil 1 und 2 aufgegriffen werden, um mit der Expertise der Teilnehmer über kreative Lösungen für konkrete Herausforderungen am ZK/U nachzudenken. Wie kann eine Grünraumpflege mit geringsten monetären Mitteln organisiert werden, führte zu Lösungsvorschlägen von Umwidmung (von einer intensiv zu einer extensiv gepflegten Fläche) bis hin zur Haltung von Tieren zur Pflege und Düngung. Wie mit einer illegalen Grillecke umzugehen sei, führte zu Lösungsansätzen, die von einer Grillhütte bis hin zu einem Gas-Grill in Verantwortung von Paten reichte.
Es war deutlich zu merken, dass die Teilnehmer*innen über ein erhebliches Maß an praktischer Erfahrung, und der Fähigkeit kreative Lösungen zu finden, verfügten.
Was fehlt im Kiez? Was sind Bedürfnisse und schlummernde Fähigkeiten von Anwohner*innen? Und wie können daraus Real-Life-Netzwerke entstehen? Das Labor stellte die Interventionen vor und leitet aus diesen Beispielen Module und Möglichkeiten für Konzepte im Stadtraum an.
Nach einem Input zu verschiedenen Stadtraumperformances der Frl. Wunder AG gab es eine erste individuelle Arbeitsphase. Die Teilnehmenden skizzierten ihre persönlichen Erinnerungs-Karten von einem interessanten Ort. Sie schrieben Listen zu vorgefundenen und überraschenden Themen und Handlungen, dachten über utopische Veränderungen und Zielgruppen nach.
Anschließend trafen wir uns im Freien wieder. Wir stellten eine Karte der Orte, über die die Teilnehmenden nachgedacht hatten und erreichten eine Ost-West Achse von Süd-Brandenburg bis Mülheim a. R. und eine Nord-Südachse von Hamburg bis Konstanz. Weitere Aufstellungen folgten als Verlauf zwischen den Polen: „ein Projekt für eine sehr klare und spezifische Zielgruppe“ – „ein Projekt für alle“, zwischen: „Ich habe ein Thema, das ich setzen möchte“ – „Ich bin offen für viele Themen“, und : Ich habe eine große Utopie“ – „Ich kenne die kleinen Spielräume des Möglichen“. Schließlich stellten diejenigen, die bereit waren ihren Ort und ihr Thema für eine Gruppenarbeit zu setzen, ihre ersten Koordinaten vor, so entstanden vier Arbeitsgruppen. Aus diesen Arbeitsgruppen wurden nach einer Pause und einer halbstündigen Arbeitsphase erste Zwischenergebnisse präsentiert:
Die erste Gruppe hatte es sich zur Aufgabe gemacht ein seit vielen Jahren stockenden Bürgerbeteiligungsprozess für ein Gelände in Braunschweig mit einer „Antibeteilungs-Aktion“ zu unterbrechen. Eine erste Idee war auf dem Gelände ein Team aus bildenden Künstlern zu situieren, die an einer „Antibeteiligungs-Skulptur“ arbeiten. Ziel dieser „Aufbau“ – Intervention ist, nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern die Aktivierung der Gelände-Nutzer*innen: selbst in Kontakt zu gehen, nachzufragen was hier geschieht und im Gespräch ihre eigene Haltung und Hoffnungen für das Gelände preiszugeben.
Einen Bahnhof mit dem Thema private Kommunikation zu verknüpfen, war der Wunsch der zweiten Gruppe. Orte der Entschleunigung und Anlässe zum Verweilen zu geben war als ein Gegenimpuls zu der vorherrschenden Atmosphäre von Transit und Hektik entstanden. Konkret wurde über leicht auf- und abbaubare Stationen nachgedacht, an denen zusammen gekocht, gespielt oder auch repariert werden kann. Eine weitere Idee war ein flashmobartiges „Begrüßungskomitee“, das unverhofft auftritt und wieder verschwindet und das von den Akteur*innen an eine nächste Gruppe weitergegeben wird.
Den öffentlichen Raum rund um eine Neubau-Siedlung hatte die dritte Gruppe im Visier. Ihr Ziel war es, eine Situation zu schaffen, aus der Menschen der Nachbarschaft beglückt nach Hause gehen können. Die Ideen reichten von einem roten Sofa auf einem Platz, wo es Kaffee und Fußmassage gibt bis zu einem Ritterturnier für Kinder. Diskutiert wurde an diesem Beispiel inwiefern es sinnvoll ist, Projekte über Potentiale und Defizite zu denken, aber auch, wie man einen Raum gleichzeitig offen für Ideen von Vielen halten kann und dennoch zu einer attraktiven Setzung kommt, die anziehend wirkt.
Die vierte Gruppe hatte ihren Ausgangspunkt anders gewählt: Wer stellt in einem Quartier überhaupt die Frage „was es hier noch braucht“? und war zu einer Zielgruppe von drei verschiedenen Transformations-Akteur*innen gekommen: 1.„die Thekengruppe – Personen die sich abends treffen und feststellen, dass zu wenig stattfindet, 2. Absolvent*innen der Sozialen Arbeit und der Künste, die ein Abschlussprojekt planen und durchführen wollen, 3. Musiker*innen, die sich zeigen wollen aber keine Plattform haben. Über die Ausstattung dieser Akteur*innen mit einem Raum und einem organisatorischen Gerüst das Regelmäßigkeit ermöglicht, können unterschiedliche Formate entstehen und Projekte wachsen, die so nachhaltig wirken, dass daraus sogar feste institutionelle Orte entstehen können – so die These.
Wie können wir etwas verändern, bewegen? Wie wollen wir unsere Nachbarschaft, unseren Stadtteil, unsere Stadt, unsere Zukunft gestalten? Wie solche Räume im Öffentlichen kreiert werden können, was ein offenes WIR braucht und welche Perspektiven und Konsequenzen es mit sich bringen kann, wurde in diesem Labor anhand von Projektbeispielen erarbeitet.
Wie können wir etwas verändern, bewegen? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir unsre Nachbarschaft, unseren Stadtteil, unsere Stadt, unsere Zukunft gestalten? Alles Fragen, bei denen meist Aspekte wie gesellschaftliche Werte, Verantwortung, Solidarität, Teilhabe, Nachhaltigkeit, Vielfalt und der Diskurs darüber herauskommen. Ganz selten wird dabei das „WIR“ in der Frage beleuchtet. Es wird vorausgesetzt, dass es dieses WIR einfach so gibt und dass dieses WIR offen ist. Wenn dem so wäre, würden wir längst so leben, wie wir leben wollen! Doch leider verhindert sich dieses WIR oft in seinen Teilen – dem Ich – selbst, in dem es Ideologien, Privilegien, die neoliberal geformte Selbstsucht und andere kulturelle Identifikationsmuster voranstellt – einteilt, aufteilt und ausgrenzt.
Dabei gibt es diese offenen Räume des WIR tagtäglich für Augenblicke überall und meist zufällig. Wie solche real-temporären Räume im Öffentlichen mit Menschen kreiert werden können, was ein offenes WIR braucht, wie jeder sich aktiv beteiligen kann und welche Perspektiven und Konsequenzen es mit sich bringen kann, waren die Schwerpunkte in diesem Labor.
Gestartet wurde mit dem kleinsten Teil eines WIR – dem Ich. Mit Körperübungen, wie zum Beispiel dem gemeinsamen ganz langsamen Gehen – entstand ein Bewusstsein für das eigene Ich in einer großen kollektiven Bewegung. Anhand von Projektbeispielen untersuchten die Teilnehmer danach verschiedene Fragestellungen, wobei die Frage: Was braucht ein offenes WIR? sehr kontrovers diskutiert wurde. Im Raum stand die These, dass ein WIR gar nicht wirklich offen sein kann, da es sich durch die Definition des WIR per se abgrenzt und damit nicht mehr offen ist. Im weiteren Verlauf des Gesprächs unter den Teilnehmern wurde klar, dass in erfolgreichen Partizipations- und Beteiligungsprojekten es wichtig ist, diese Definition des WIR immer wieder aufzulösen und zu erneuern, so dass jeder Teil des Ganzen (WIR) aber auch ein ganzes Teil (Ich) sein kann. Diese Offenheit ist ein permanenter dynamischer Prozess – sehr arbeitsintensiv, aber so wesentlich für eine aktive Teilhabe.
Von diesem theoretischen Gesprächsergebnis starteten alle Teilnehmer dieses praktisch gemeinsam in einem Versuch zu erarbeiten und umzusetzen. Mit der Frage „Was braucht ein offenes WIR?“ ging es in den öffentlichen Raum um Antworten zu suchen. Jede Antwort, egal welcher Art, kam in einen rosa Luftballon, der aufgeblasen wurde. Zum Abschluss des Labors formten die Teilnehmer die Ballons zu einem überdimensionalen Gehirn – dem „Collective brain“ und präsentierten den Inhalt gemeinsam bis die Luft ausging.